1. Einführung
Osteoporose entsteht, wenn im natürlichen Knochenumbau mehr Knochengewebe abgebaut als neu aufgebaut wird, was zu einer verringerten Knochendichte führt (Kanis et al., 2019). Umgangssprachlich ist sie als Knochenschwund bekannt.
Weltweit sind etwa 10 bis 20 % der über 50-Jährigen betroffen, wobei Frauen – insbesondere nach den Wechseljahren – ein deutlich höheres Risiko aufweisen als Männer. In Europa leiden schätzungsweise 30 bis 40 % der Frauen über 50 an Osteoporose, bei Männern liegt der Anteil bei 10 bis 15 % (Kanis et al., 2019).
Die Erkrankung erhöht das Risiko für Knochenbrüche erheblich und kann die Lebensqualität stark beeinträchtigen (Cooper et al. 2011). Besonders häufig treten Frakturen an Hüfte, Wirbelsäule und Handgelenken auf. Während Wirbelkörperbrüche mitunter unbemerkt bleiben, können sie zu chronischen Rückenschmerzen und einer Verformung der Wirbelsäule – dem sogenannten ›Witwenbuckel‹ – führen. Hüftfrakturen erfordern meist eine Operation und führen nicht selten zu dauerhafter Mobilitätseinschränkung (Cooper et al., 2011).
Neben den körperlichen Folgen bringt Osteoporose auch erhebliche psychosoziale Belastungen mit sich: Die ständige Angst vor Stürzen und möglichen Brüchen kann das Sicherheitsgefühl im Alltag untergraben, die Selbstständigkeit einschränken und sogar zu depressiven Verstimmungen führen (Kanis et al., 2019).
Umso wichtiger ist es, frühzeitig vorzubeugen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen: Durch eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität und gezielte Vorsorgeuntersuchungen lässt sich das Risiko deutlich senken (Kanis et al., 2019).
Sie haben es selbst in der Hand, aktiv zur Erhaltung Ihrer Knochengesundheit beizutragen und Ihre Lebensqualität langfristig zu sichern. Unser Team begleitet Sie dabei mit maßgeschneiderten Programmen und individueller Beratung auf Ihrem Weg.
2. Ursachen und Risikofaktoren
Osteoporose entsteht durch ein Ungleichgewicht zwischen Knochenaufbau und -abbau. Während in jungen Jahren fortlaufend neue Knochensubstanz gebildet wird, überwiegt mit zunehmendem Alter der Abbau. Verschiedene Ursachen und Risikofaktoren können diesen Prozess zusätzlich beschleunigen.
3. Symptome und Diagnostik – Warnsignale erkennen, gezielt handeln
Osteoporose entwickelt sich oft schleichend und bleibt lange Zeit symptomfrei. Erste Anzeichen sind häufig unspezifisch – dennoch gibt es einige Warnsignale, auf die Sie achten sollten.
Frühe Anzeichen – hören Sie auf Ihren Körper
Fortgeschrittene Symptome – wenn es akuter wird
Diagnostik
Zur frühzeitigen Erkennung von Osteoporose und zur Abschätzung des Frakturrisikos stehen verschiedene Untersuchungen zur Verfügung:
Mit einem genauen Blick auf Ihre Symptome und einer gezielten Diagnostik legen Sie selbst den Grundstein für wirkungsvolle Maßnahmen. Unser Team begleitet Sie dabei, Ihre Knochengesundheit aktiv zu fördern und langfristig zu stabilisieren.
4. Behandlungsmöglichkeiten – aktiv für starke Knochen sorgen
Ziel der Osteoporosebehandlung ist es, das Frakturrisiko zu senken, den Knochenabbau zu verlangsamen und Beschwerden zu lindern. Dabei stehen Sie im Mittelpunkt: Je konsequenter Sie mitarbeiten, desto nachhaltiger ist Ihr Erfolg.
5. Prognose und Verlauf
Osteoporose verläuft chronisch und wird maßgeblich von Früherkennung, konsequenter Behandlung und einem angepassten Lebensstil bestimmt. Frühzeitig eingeleitete Gegenmaßnahmen können den Krankheitsverlauf deutlich verlangsamen und das Frakturrisiko reduzieren, während unbehandelt der kontinuierliche Knochenverlust das Risiko für Brüche und Immobilität erhöht (Kanis et al., 2019)
Prognose und Lebenserwartung – Ihr Beitrag zählt
Osteoporose selbst ist nicht unmittelbar lebensbedrohlich, kann jedoch indirekt die Lebenserwartung beeinträchtigen: Folgekomplikationen nach Frakturen – insbesondere Hüftbrüchen – erhöhen die Sterblichkeit (Cleveland Clinic, 2025).
Je früher Sie aktiv werden und empfohlene Maßnahmen umsetzen, desto günstiger verläuft Ihre Osteoporose. Mit Anpassungen in Ernährung, Bewegung und gezielten Therapien können Sie das Fortschreiten bremsen und Ihre Lebensqualität sichern.
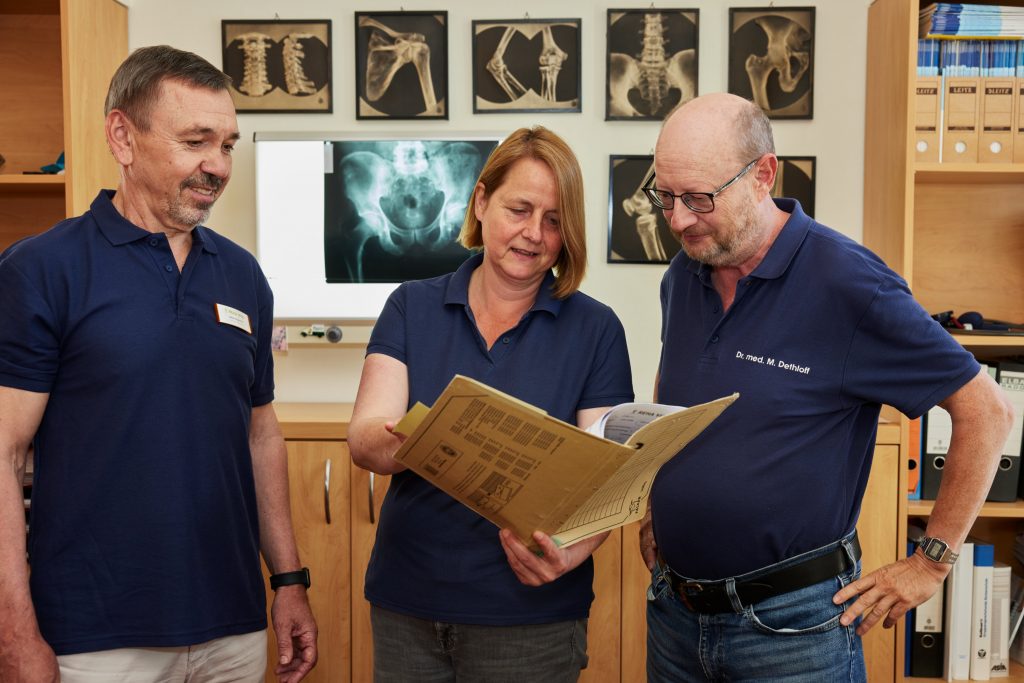
6. Prävention – aktiv Knochen stärken und Risiken minimieren
Die Vorbeugung von Osteoporose ist zentral, um Knochenbrüche zu vermeiden und die Lebensqualität langfristig zu sichern. Folgende Maßnahmen sind besonders wirksam:
7. Unterstützende Angebote und Ressourcen
Für den Umgang mit Osteoporose stehen verschiedene Hilfsangebote zur Verfügung:
8. Unsere Rehazentren
rehaneo kann Ihnen helfen, dies zu verhindern
9. Quellenverzeichnis
- Bartl, R., & Bartl, C. (2021). Das Osteoporose-Manual: Biologie, Diagnostik, Prävention und Therapie (1. Aufl.). Springer.
Cooper, C., Cole, Z. A., Holroyd, C. R., Earl, S. C., Harvey, N. C., Dennison, E. M., … & Kanis, J. A. (2011). Secular trends in the incidence of hip and other osteoporotic fractures. Osteoporosis International, 22(5), 1277-1288. doi: 10.1007/s00198-010-1404-8
Kanis, J. A., Cooper, C., Rizzoli, R., & Reginster, J. Y. (2019). European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporosis International, 30(1), 3-16. doi: 10.1007/s00198-018-4704-5 - Lips, P., Cashman, K. D., Lamberg-Allardt, C. J., Bischoff-Ferrari, H. A., Obermayer-Pietsch, B., Bianchi, M. L., … & Gruson, D. (2019). Vitamin D status and health outcomes in adults: A review. Nutrients, 11(13), 2841. doi: 10.3390/nu11132841
- Medical News Today (2023). Osteoporosis prognosis and life expectancy. Verfügbar unter: https://www.medicalnewstoday.com/articles/osteoporosis-prognosis
- Cleveland Clinic (2025). Osteoporosis: Symptoms, Causes and Treatment. Verfügbar unter: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4443-osteoporosis
- National Osteoporosis Foundation (2023). Osteoporosis: What You Need to Know. Verfügbar unter: https://www.nof.org/patients/what-is-osteoporosis/
- Mayo Clinic (2023). Osteoporosis. Verfügbar unter: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/osteoporosis/symptoms-causes/syc-20351968
- Cipriani, C., Irani, D., & Isaia, G. C. (2012). Bone turnover and the use of teriparatide in osteoporosis. European Journal of Clinical Pharmacology, 68(11), 1511–1521.
- Esen, E., Lee, S. Y., Wice, B. M., & Long, F. (2015). PTH signaling through PI3K regulates mesenchymal stem cell proliferation and differentiation. Bone Research, 3, 15034.
Jilka, R. L. (2007). Molecular and cellular mechanisms of bone remodeling. Journal of Clinical Investigation, 117(10), 2479–2488. - Kim, S. W., Pajevic, P. D., Selig, M., Barry, K. J., Yang, J. Y., Shin, C. S., … & Kronenberg, H. M. (2012). Interspecies comparison of the effects of chronic PTH or PTHrP administration on mouse and human bone. Journal of Bone and Mineral Research, 27(10), 2128–2143.
- Eriksen, E. F., Boyce, R. W., Shi, Y., Brown, J. P., Betah, D., Libanati, C., … & Chavassieux, P. (2024). Reconstruction of remodeling units reveals positive effects after 2 and 12 months of romosozumab treatment. Journal of Bone and Mineral Research, 39(6), 729–736.
- Shi, Y., & Long, F. (2019). Wnt signaling in bone metabolism. Journal of Bone and Mineral Research, 34(5), 819–828.
- Delmas, P. D., Bjarnason, N. H., Mitlak, B. H., Ravoux, A. C., Shah, A. S., Huster, W. J., … & Christiansen, C. (1997). Effects of raloxifene on bone mineral density, serum cholesterol concentrations, and uterine endometrium in postmenopausal women. New England Journal of Medicine, 337(23), 1641–1647.
- Ettinger, B., Black, D. M., Mitlak, B. H., Knickerbocker, R. K., Nickelsen, T., Genant, H. K., … & Delmas, P. D. (1999). Reduction of vertebral fracture risk in postmenopausal women with osteoporosis treated with raloxifene: results from a 3-year randomized clinical trial. Journal of the American Medical Association, 282(7), 637–645.
- Cauley, J. A., Robbins, J., Chen, Z., Cummings, S. R., Jackson, R. D., LaCroix, A. Z., … & Women’s Health Initiative Investigators. (2003). Effects of estrogen plus progestin on risk of fracture and bone mineral density: the Women’s Health Initiative randomized trial. Journal of the American Medical Association, 290(13), 1729–1738.
















